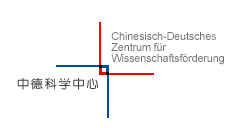Jussi Grießinger
Jussi Grießinger, Akad. Direktor

- Google Scholar: Seite von Jussi Grießinger
- ORCID: Seite von Jussi Grießinger
- Research Gate: Seite von Jussi Grießinger
Sprechstunde
Keine Sprechstunde mehr
Hochgebirge zeichnen sich Allgemein durch ein hohes Maß an raum-zeitlichen Veränderungen aus – sei es durch natürlich induzierte Prozesse wie z.B. rezente Geomorphodynamik, aber auch durch teilweise regionenspezifisch individuelle Landnutzungssysteme (z.B. Terrassensysteme) und Siedlungslagen (z.B. auf Schwemmfächern). Diese Systeme können durch ihre teilweise hochgradige Anpassung an ihre Umwelt bis zu einem gewissen Punkt rasch auf kurzfristige Änderungen wie kleinräumige Extremereignisse, Schadensereignisse oder langsam ablaufende Veränderungen in ihrer Umwelt reagieren. Für schnell ablaufende und vor allem mesoskalig wirksame Prozesse, wie Sie z.B. verheerende Naturkatastrophen wie GLOF´s, Land slides oder großräumig wirksame rezente Klimaänderungen darstellen, steigt deren Verwundbarkeitsexposition jedoch beträchtlich. Insbesondere in Hochgebirgen fehlt jedoch oftmals eine belastbare Datenquelle, die Veränderungen im Klimasystem ausreichend belegen kann. Hier sind an der Schnittstelle zwischen Physischer Geographie (z.B. Informationen zur Paläoklimatologie/Klimatologie in einer Region als Grundlage für eine Quantifizierung eines Klima- und Umweltwandels) und Kulturgeographie (z.B. Untersuchungen zur Wahrnehmung eines Umwelt- und Klimawandels, angepasste Landnutzungssysteme) gemeinsame Untersuchungen notwendig, um auf mögliche Veränderungen entsprechend reagieren zu können.
Der Interessens-Schwerpunkt meiner Arbeiten liegt in der Quantifizierung und Regionalisierung des Klimawandels sowie den damit verbundenen Änderungen in den Wasserkreisläufen ausgesuchter (Hoch)Gebirgsräume Asiens, Europas und Südamerikas. Dabei wird über verschiedene Skalen hinweg gearbeitet, die zum Einen in einem strikt paläoklimatologischen Kontext zu sehen sind (Arbeiten mit Proxydatensätzen und hier v.a. mit aus Bäumen und Sträuchern abgeleiteten Parametern wie Jahrringbreite, Variationen stabiler Isotope in Jahrringen (δ13C, δ18O, δ2H), Arbeiten zur Gletscher- und Landschaftsgeschichte; Arbeiten zur Variabilität des Hydroklimas & zur Klimageschichte seit der MWP/ dem LIA), zum Anderen im Überschneidungszeitraum zwischen industriellem Zeitalter, dem Zeitraum instrumentell gemessener Klimadaten und Zeiträumen der Klimamodellierung arbeiten. Gerade der Vergleich zwischen Klima-Stellvertreterdaten und Re-Analysedaten birgt durch eine gegenseitige Validierung der Ergebnisse großes Potential zur Verbesserung der Aussagen zum Klima- und Umweltwandel in Naturräumen mit räumlich lückenhaften Messnetzen bei gleichzeitig hoher topoklimatischer Variabilität. Zusätzlich bieten sich weitreichende und fundierte Anknüpfungspunkte zu Arbeiten in der Hazardforschung, Mensch-Umwelt-Forschung, zum Landnutzungswandel und zu Fragen der Existenzsicherung in Lebensräumen am Rande der Ökumene, die in hohem Maße auf Veränderungen ihrer Umwelt sensitiv reagieren. Hierzu wird intensiv mit den dazu forschenden Kolleginnen und Kollegen aus der Kulturgeographie am Institut zusammengearbeitet.
ab 10/2023: Übernahme der Professur für Physische Geographie, Paris Lodron Universität Salzburg, Fachbereich Umwelt und Biodiversität
9/2021-9/2023: Akademischer Direktor / FAU Erlangen-Nürnberg, Institut für Geographie / Leiter der Geschäftststelle des Instituts für Geographie
8/2021: Presidents International Fellow, Chinese Academy of Sciences
SoSem 2021: Vertretungsprofessor / Univ.-Professor für Klimatologie (W2), Institut für Geographie, Universität Bayreuth
12/2019: Privatdozent; Erteilung der venia legendi für Physische Geographie
11/2019: Habilitation in Physischer Geographie (Dr. habil; facultas docendi)
Habilitationsschrift: Perspectives on climate variability and climate change in high-mountain ecosystems using tree-ring parameters.
Mentoren: Prof. Dr. A. Bräuning (FAU Erlangen-Nürnberg; Biogeographie), Prof. Dr. M. Braun (FAU Erlangen-Nürnberg; GIS und Fernerkundung), Prof. Dr. J. Böhner (Univ. Hamburg; Klimatologie).
7/2016: Lehrpreis der FSI Geographie
6/2016-9/2021: Akademischer Oberrat / FAU Erlangen-Nürnberg, Institut für Geographie / Leiter der Geschäftststelle des Instituts für Geographie
4/2013-5/2016: Akademischer Rat / FAU Erlangen-Nürnberg, Institut für Geographie / Leiter der Geschäftststelle des Instituts für Geographie
10/2006-3/2013: Lehrkraft für besondere Aufgaben (LfbA, Hochdeputats-Lehrkraft 13-19 SWS) / FAU Erlangen-Nürnberg, Institut für Geographie
3/2008: Promotion zum Dr. rer. nat.
Dissertationsschrift: Untersuchungen zur Klimavariabilität auf dem Tibetischen Plateau: Ein Beitrag auf der Basis stabiler Kohlenstoff- und Sauerstoffisotope in Jahrringen von Bäumen waldgrenznaher Standorte. Universität Stuttgart
Betreuer: Prof. Dr. W.D. Blümel (Univ. Stuttgart), Prof. Dr. G.H. Schleser (FZ Jülich), Prof. Dr. A. Bräuning (FAU Erlangen-Nürnberg).
10/2003-9/2006: Wissenschaftlicher Angestellter (Doktorand) / Forschungszentrum Jülich, Institut für Chemie und Dynamik der Geosphäre (ICG-V), Abteilung Isotopen-Geochemie und Paläoklima (AG Prof. G.H. Schleser)
10/1996-4/2003: Studium der Geographie (Diplom) / Universitäten Stuttgart & Hohenheim / Nebenfächer: Geologie, Bodenkunde, Landschaftsplanung, Landschafts- und Pflanzenökologie.
Diplomarbeit: Morphologische Entwicklung im Umfeld der ostfriesischen Inseln Wangerooge: Eine GIS-gestützte Analyse. Universität Stuttgart.
Betreuer: Prof. Dr. W.D. Blümel (Univ. Stuttgart), Dr. C. Meyer (NLWK-FSK Norderney); Dipl.-Ing. F. Ladage (NLWK-FSK Norderney).
ORCID-ID: 0000-0001-6103-2071
Scopus Author ID: 15070397200
Web of Science Researcher ID: D-6318-2013
Reviewer-Tätigkeit unter anderem für Climate Dynamics, Climatic Change, Dendrochronologia, Earth and Planetary Science Letters, Geographica Helvetica, Global and Planetary Change, Geophysical Research Letters, Journal of Climate, JGR-Atmosphere, JGR-Biogeoscience, Nature Geoscience, New Phytologist, Palaeo-3, Quaternary International, Quaternary Science Reviews, Science, Trees – Structure and Function.
Editoren-Tätigkeiten: Review Editor Frontiers in Temperate and Boreal Forests; Topic Editor MDPI Geosciences
Boards: Scientific Advisory Board „Tree-Ring Society“, Mitglied Sprecherteam des Arbeitskreises Hochgebirge des VGDH
Peer-reviewed Artikel in Fachjournalen, Buchbeiträge und Tagungsbände:
2023
- Wang, L., Liu, H., Grießinger, J., Chen, D., Sun, C & C. Fang (2023): Enhanced variability and declining trend of soil moisture since the 1880s on the southeastern Tibetan Plateau. Water Resources Research 59, e2022WR033953. https://doi.org/10.1029/2022WR033953.
- Soto-Rogel, P., Aravena, J.-C., Villalba, R., Meier, W. J.-H. & J. Grießinger (2023): Tree-ring δ18O variations in Nothofagus species record large-scale climatic signals in the South American sector of the Southern Ocean. Palaeo-3: Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 617, 111474. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2023.111474.
- Aryal, S., Grießinger, J., Arsalani, M., Meier, W. J.-H., Fu, P.-L., Ze-Xin, F. & A. Bräuning (2023): Insect infestations have an impact on the quality of climate reconstructions using Larix ring-width chronologies from the Tibetan Plateau. Ecological Indicators 148, 110124. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2023.110124
- Chinthala, B.D., Ranhotra, P.S., Grießinger, J., Singh, C.P. & A. Bräuning (2023): Himalayan fir reveals moist phase during the Little Ice Age in the Kashmir region of the Western Himalayas. Quaternary Research 312, 10816. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2023.108167
- Gaire, N.P., Zaw, Z., Bräuning, A., Grießinger, J., Sharma, B., Rana, P., Bhandari, S., Basnet, S. & F. Ze-Xin (2023): Climate response of Himalayan silver fir along an elevation gradient in the Mt. Everest region. Agricultural and Forest Meteorology 339, 109575. https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2023.109575.
- Huang, R., Xu, C., Grießinger, J., Feng, X., Zhu, H. & A. Bräuning (2023): A review of stable isotopes in tree rings based on bibliometric analysis. Journal of Forestry Research (accepted).
- Zhao, Y., Yao, B., Zhang, P., Luo, J., Grießinger, J., Zhang, H., Liang, C., Ma, Z., Gu, H. & Y. Zhang (2023): Inter-tree correlation and climatic response of tree-ring δ18O in living Chinese fir: implications for coffin wood-based dendroclimatological research in Central East China. Dendrochronologia 81, 126134. https://doi.org/10.1016/j.dendro.2023.126134
- Wang, L., Liu, H., Shi, L., Zhang, Z., Liang, B., Huang, R., Grießinger, J. & S. Leavitt (2023): Divergent CO2 fertilization effects on tree species of the same plant functional type. (Agricultural and Forest Meteorology; under review)
- Aryal, S., Grießinger, J., Dyola, N., Gaire, N.P., Bhattarai, T. & A. Bräuning (2023): INTRAGRO – A novel approach to predict the intra- and inter-annual growth of trees under climate change scenarios. Ecology and Evolution (accepted). https://doi.org/10.1002/ece3.10626
- Aryal, S., Grießinger, J., Gaire, N., Bhattarai, T. & A. Bräuning (2023): Drought, Temperature and Moisture availability: Understanding the drivers of isotopic decoupling in native Pine species of the Nepalese Himalaya. (Intl. Journal of Biometeorology; under review)
- Zhao, Y., Lu, H., Fang, K., Zhang, P., Bräuning, A., Grießinger, J., Liang, C., Zhang, H., Sun, Y., Jin, Q., Li, J., Ma, Z. & J. Wang (2023): The mechanism underlying the relationship between tree-ring oxygen isotopes and hydroclimate in the Meiyu region of East Asia. (Chemical Geology, under review).
2022
- Grießinger, J., Meier, W. J.-H. & P. Hochreuther (2022): Decreasing water availability as a threat for traditional irrigation-based land-use systems in the Mustang Himalaya/Nepal. In: Schickhoff, U., Singh, R.B. & S. Mal (eds.): Mountain Landscapes in Transition: Effects of land-use and climate change, pp. 253-266. Springer Sustainable Development Goals Series, Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-70238-0_8
- Yang, R.-Q.; Zhao, F., Fan, Z.-X., Panthi, S., Fu, P.-L., Li, Z.-S., Grießinger, J. & A. Bräuning (2022): Recent growth decline of Abies delavayi is driven by stomatal responsiveness to warming climate in the Cangshan Mountain, southwestern China. Forest Ecology & Management 505(12):119943. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2021.119943
- Huang, R., Zhu, H., Liang, E., Bräuning, A., Zhong, L., Xu, C., Feng, X., Asad, F., Sigdel, S.R., Li, L. & J. Grießinger (2022): Contribution of winter precipitation to tree growth persists until the late growing season in the Karakoram of northern Pakistan. Journal of Hydrology; 127513. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2022.127513
- Chinthala, B.D., Grießinger, J., Ranhotra, P.S., Tomar, N., Singh, C.P. & A. Bräuning (2022): Tree–ring oxygen isotope variations in subalpine firs from the western Himalaya capture spring season temperature signals. Atmosphere 2022, 13(3), 437. https://doi.org/10.3390/f13030437
- Feng, X., Huang, R., Zhu, H., Liang, E., Bräuning, A., Zhong, L., Gong, Z., Zhang, P., Azad, F., Zhu, X. & J. Grießinger (2022): Do tree-ring cellulose oxygen isotopes from the western Kunlun Mountains record atmospheric aridity? Ecological Indicators 137, 108776. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2022.108776
- Yang, B., Qin, C., Bräuning, A., Osborn, T.J., Trouet, V., Lungqvist, F.C., Esper, J., Schneider, L., Grießinger, J., Büntgen, Ulf, Rossi, S., Dong, G., Yang, M., Ning, L., Wang, J., Wang, X., Fan, B., Wang, S., Luterbacher, J., Cook, E.R. & N.C. Stenseth (2022): Reply to Weiss: Tree-ring stable oxygen isotopes suggest an increase in Monsoonal rainfall at 4.2ka BP. PNAS – Proceedings of the National Academy of Sciences 119 (20), e2204067119; https://doi.org/10.1073/pnas.2204067119
- Soto-Rogel, P., Aravena, J.C., Bringas, C., Meier, W. J.-H., Gonzalez-Reyes, Á. & J. Grießinger (2022): Two Nothofagus species in southernmost South America are recording divergent climate signals. Forests 13 (5), 794. https://doi.org/10.3390/f13050794
- Wang, L., Chen, D., Zhang, P., Leavitt, S., Liu, Y., Fang, C., Sun, C., Cai, Q., Liang, B., Shi, L., Liu, F., Zheng, Y., Gui, Z. & J. Grießinger (2022): The 1820s marks a shift to hotter-drier summers in Western Europe since 1360. Geophysical Research Letters 49, e2022GL099692, https://doi.org/10.1029/2022GL099692.
- Meier, W.J.-H., Pohle, P. & J. Grießinger (2022): Climate change and new markets: multi-factorial drivers of recent land-use change in the semi-arid Trans-Himalaya, Nepal. Land 2022, 11(9), 1567. https://doi.org/10.3390/land11091567
- Arsalani, M., Grießinger, J. & A. Bräuning (2022): Long-term variations of winter and summer maximum temperatures and ecological consequences of recent warming for forest health in the Zagros Mts., Iran. Intl. Journal of Biometeorology, https://doi.org/10.1007/s00484-022-02380-5
2021
- Grießinger, J., Meier, W. J.-H., Bast, A., Debel, A., Gärtner-Roer, I. & H. Gärtner (2021): Permafrost biases climate signals in δ18O tree-ring series from a sub-alpine tree stand in Val Bever/Switzerland. Atmosphere 2021, 12 (7), 836. https://doi.org/10.3390/atmos12070836
- Bao, Y., Qin, C., Bräuning, A., Osborn, T.J., Trouet, V., Ljungqvist, F.C., Esper, J., Schneider, L., Grießinger, J., Büntgen, U., Rossi, S., Dong, G., Mi, Y., Ning, L., Wang, J., Wang, X., Wang, S., Luterbacher, J., Cook, E.R. & N.C. Stenseth (2021): Long-term decrease in Asian monsoon rainfall and abrupt climate change events over the past 6,700 years. PNAS – Proceedings of the National Academy of Sciences 118 (30) e2102007118; https://doi.org/10.1073/pnas.2102007118.
- Büntgen, U., Allen, K., Anchukaitis, K., Arseneault, D., Boucher, É., Bräuning, A., Chatterjee, S., Cherubini, P., Churakova, O.P., Corona, C., Gennaretti, F., Grießinger, J., Guillet, S., Guiot, J., Gunnarson, B., Helama, S., Hochreuther, P., Hughes, M.K., Huybers, P., Kirdyanov, A.V., Krusic, P.J., Ludescher, J., Meier, W.J.-H., Myglan, V.S., Nicolussi, K., Oppenheimer, C., Reinig, F., Salzer, M.W., Seftigen, K., Stine, A.R., Stoffel, M., St. George, S., Tejedor, E., Trevino, A., Trouet, V., Wang, J., Wilson, R., Yang, B., Xu, G. & J. Esper (2021): The influence of decision-making in tree ring-based climate reconstructions. Nature Communications 12, 3411 (2021) https://doi.org/10.1038/s41467-021-23627-6.
- Zhu, H., Huang, R., Asad, F., Liang, E., Bräuning, A., Zhang, X., Dawadi, B., Man, W. & J. Grießinger (2021): Unexpected climate variability inferred from a 380-year tree-ring earlywood oxygen isotope record in the Karakoram, Northern Pakistan. Climate Dynamics 2021, https://doi.org/10.1007/s00382-021-05736-6.
- Arsalani, M., Grießinger, J., Pourthamasi, K. & A. Bräuning (2021): Multi-centennial reconstruction of drought events in south-western Iran using tree rings of Mediterranean cypress (Cupressus sempervirens L.). Palaeo-3: Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 587, 110256. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2021.110296
- He, M., Bräuning, A., Rossi, S., Gebrekirstos, A., Grießinger, J. & C. Mayr (2021): No evidence for carryover effect in tree rings based on a pulse-labelling experiment on Juniperus communis in South Germany. Trees (35):493–502. https://doi.org/10.1007/s00468-020-02051-1
2020
- Landshuter, N., Mölg, T., Grießinger, J., Bräuning, A. & T. Peters (2020): 10-year characteristics of moisture source regions and their potential effect on seasonal isotopic signatures of δ18O in tropical trees of southern Ecuador. Frontiers in Earth Science 8:604804. https://doi.org/10.3389/feart.2020.604804
- Aryal, S., Häusser, M., Grießinger, J., Fan, Z.-X., & A. Bräuning (2020): “dendRoAnalyst”: A tool for processing and analysing dendrometer data. Dendrochronologia 64, 125772 (2020). https://doi.org/10.1016/j.dendro.2020.125772
- Meier, W.J-H., Aravena, J., Hochreuther, P., Soto-Rogel, P., Jana, R., Braun, M.H. & J. Grießinger (2020): A tree-ring δ18O series from southernmost Fuego‑Patagonia is recording flavors of the Antarctic Oscillation. Global and Planetary Change 195 (2020), 103302. https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2020.103302
-
Foroozan, P., Grießinger, J., Pourtahmasi, K. & A. Bräuning (2020): A 501 year spring precipitation reconstruction for the semi-arid northern Iran derived from tree-ring δ18O data. Atmosphere 2020,11(9), 889. https://doi.org/10.3390/atmos11090889
-
Soto-Rogel, P., Aravena, J.C., Meier, W. J.-H., Gross, P., Pérez, C., González-Reyes, A. & J. Grießinger (2020): Impact of extreme weather events on aboveground net primary productivity and sheep production in the Magellan region, southernmost Chilean Patagonia. Geosciences 2020, 10(8), 318. https://doi.org/10.3390/geosciences10080318
- Bräuning, A. & J. Grießinger (2020): Welche Umweltinformationen können aus Jahrringen von Bäumen abgeleitet werden? In: J.L. Lozán, E.W. Breckle, H. Escher-Vetter, H. Grassl, D. Kasang, F. Paul & U. Schickhoff (Eds.): Warnsignal Klima: Hochgebirge im Wandel: 23-27. www.klima-warnsignale.uni-hamburg.de.
- Schneider, C., Braun, M.H., Grießinger, J. & G. Cassassa (2020): Editorial: Climate Impacts on Glaciers and Biosphere in Fuego-Patagonia. Frontiers in Earth Sciences 8:91. https://doi.org/10.3389/feart.2020.00091
- Aryal, S., Gaire, N.P., Pokhrel, N.R., Rana, P., Sharma, B., Kharal, D.K., Poudel, B.S., Dyola, N., Fan, Z.-X., Grießinger, J. & A. Bräuning (2020): Spring season in western Nepal Himalaya is not yet warming: A 400-year temperature reconstruction based on tree-ring widths of Himalayan Hemlock (Tsuga dumosa). Atmosphere 2020, 11 (2), 132. https://doi.org/10.3390/atmos11020132
2019
- Fan, Z.-X., Bräuning, A., Fu, P.-L., Yang, R.-Q., Qi, J.-H., Grießinger, J. & A. Gebrekirstos (2019): Intra-annual radial growth of Pinus kesiya var. liangbianensis is mainly controlled by moisture availability in the Ailao Mountains, southwestern China. Forests 2019, 10 (10), 899. https://doi.org/10.3390/f10100899.
- Meier, W.J.-H., Aravena, J.C., Grießinger, J., Hochreuther, P., Soto-Rogel, P., Zhu, H., De Pol-Holz, R., Schneider, C. & M.H. Braun (2019): Late Holocene glacier fluctuations of Glacier Schiaparelli at Monte Sarmiento Massif, Tierra del Fuego (54°24′S). Geosciences 2019, 9 (8), 340. https://doi.org/10.3390/geosciences9080340.
- Foroozan, Z., Grießinger, J., Pourthamasi, K. & Bräuning, A. (2019): Evaluation of different pooling methods to establish a multi-century δ18O chronology for paleoclimate reconstruction. Geosciences 2019, 9 (6), 270. https://doi.org/10.3390/geosciences9060270.
- Huang, R., Zhu, H., Liang, E., Grießinger, J., Dawadi, B. & A. Bräuning (2019): High-elevation shrub-ring δ18O on the northern slope of the central Himalayas records summer (May–July) temperatures. Paleogeography, Paleoclimatology, Paleoecology 524:230-239. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2019.03.038.
- Grießinger, J., Bräuning, A., Helle, G., Schleser, G.H., Hochreuther, P., Meier, W.J-H. & H. Zhu (2019): A Dual Stable Isotope Approach Unravels Common Climate Signals and Species-Specific Responses to Environmental Change Stored in Multi-Century Tree-Ring Series from the Tibetan Plateau. Geosciences 2019, 9 (4), 151. https://doi.org/10.3390/geosciences9040151.
- Huang, R., Zhu, H., Liang, E., Azad, F. & J. Grießinger (2019): A tree-ring–based summer (June–July) minimum temperature reconstruction for the western Kunlun Mountains since AD 1681. Theoretical and Applied Climatology 138:673-682. https://doi.org/10.1007/s00704-019-02849-1
- Huang, R., Zhu, H., Liang, E., Liu, B., Shi, J., Zhang, R. & J. Grießinger (2019): A tree-ring based winter temperature reconstruction on the southeastern Tibetan plateau since 1365 CE. Climate Dynamics 53 (5-6):3221-3233. https://doi.org/10.1007/s00382-019-04695-3
- Wernicke, J., Stark, G., Wang, L., Grießinger, J., & A. Bräuning (2019): Air moisture signals in a stable oxygen isotope chronology of dwarf shrubs from the central Tibetan Plateau. Annals of Botany 124 (1):53-64. https://doi.org/10.1093/aob/mcz030
- He, M., Yang, B., Bräuning, A., Rossi, S., Ljungqvist, F.C., Shishov, V., Grießinger, J., Wang, J., Liu, J. & C. Qin (2019): Recent advances in dendroclimatology in China. Earth-Science Reviews 194:521-534. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2019.02.012
- Zhu, H., Shao, X., Zhang, H., Asad, F., Sigdel, S.R., Huang, R., Li, Y., Liu, W., Muhammad, S., Hussain, I., Grießinger, J. & E. Liang (2019): Trees record changes of the temperate glaciers on the Tibetan Plateau: potential and uncertainty. Global and Planetary Change 173:15-23. https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2018.12.004
- Huang, R., Zhu, H., Liang, E., Grießinger, J., Wernicke, J., Yu, W., Hochreuther, P., Risi, C., Zeng, Y., Fremme, A., Sodemann, H. & A. Bräuning (2019): Temperature signals in tree-ring oxygen isotope series from the northern slope of the Himalayas. Earth and Planetary Science Letters 506:45-465. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2018.11.002
2018
- Buentgen, U., Wacker, L., Galvan, D., Arnold, S., Arseneault, D., Baillie, M., Beer, J., Bernabei, M., Bleicher, N., Boswijk, G., Bräuning, A., Carrer, M., Ljungqvist, F., Cherubini, P., Christl, M., Christie, D., Clark, P., Cook, E., D’Arrigo, R., Davi, N., Eggertsson, O., Esper, J., Fowler, A., Gedalof, Z., Gennaretti, F., Grießinger, J., Grissino-Mayer, H., Grudd, H., Gunnarson, B., Hantemirov, R.,Herzig, F., Hessl, A., Heussner, K.-U., Jull, T., Kukarskih, V., Kirdyanov, A., Kolar, T., Krusic, P., Kyncl, T., Lara, A., LeQuesne, C., Linderholm, H., Loader, N., Luckman, B., Miyake, F., Myglan, V., Nicolussi, K., Oppenheimer, C., Palmer, J., Panyushkina, I., Pederson, N., Rybnicek, M., Schweingruber, F., Seim, A., Sigl, M., Churakova, O., Speer, J., Synal, H.-A., Tegel, W., Treydte, K., Villalba, R., Wiles, G., Wilson, R., Winship, L., Wunder, J., Yang, B. & G. Young (2018): Tree rings reveal globally coherent signature of cosmogenic radiocarbon events in 774 and 993 CE. Nature Communications 9, 3605 (2018). https://doi.org/10.1038/s41467-018-06036-0
- Meier, W. J-H., Hochreuther, P., Grießinger, J., & M.H. Braun (2018): An updated multi-temporal glacier inventory for the Patagonian Andes with changes between the Little Ice Age and 2016. Frontiers in Earth Sciences 6, 62. https://doi.org/10.3389/feart.2018.00062
- Grießinger, J., Langhamer, L., Schneider, C., Saß, B.L., Steger, D., Skvarca, P., Braun, M.H., Meier, W.J.-H., Srur, A.M. & P. Hochreuther (2018): Imprints of climate signals in a 204 year δ18O tree-ring record of Nothofagus pumilio from Perito Moreno Glacier, southern Patagonia (50°S). Frontiers in Earth Sciences 6, 27. https://doi.org/10.3389/feart.2018.00027
- He, M., Bräuning, A., Grießinger, J., Hochreuther, P. & J. Wernicke (2018): May–June drought reconstruction over the past 821 years on the south-central Tibetan Plateau derived from tree-ring width. Dendrochronologia 47:48-57. https://doi.org/10.1016/j.dendro.2017.12.006
- He, M., Yang, B., Shishov, V., Rossi, S., Bräuning, A., Ljungqvist, F.C. & J. Grießinger (2018): Relationships between Wood Formation and Cambium Phenology on the Tibetan Plateau during 1960–2014. Forest Ecology & Management 9(2), 86. https://doi.org/10.3390/f9020086.
2017
- He, M., Yang, B., Shishov, V., Rossi, S., Bräuning, A., Ljungqvist, F.C. & J. Grießinger (2017): Projections for the changes in growing season length of tree-ring formation on the Tibetan Plateau based on CMIP5 model simulations. International Journal of Biometeorology 62:631-641. https://doi.org/10.1007/s00484-017-1472-4
- Yang, B., He, M., Shishov, V., Tychkov, I., Vaganov, E., Rossi, S., Ljungqvist, F.C., Bräuning, A. & J. Grießinger (2017): A new perspective on spring vegetation phenology and global climate change based on Tibetan plateau tree-ring data. Proceedings of the National Academy of Sciences PNAS 114 (27):6966-6971. https://doi.org/10.1073/pnas.1616608114
- He, M., Shishov, V., Kaparova, N., Yang, B., Bräuning, A. & J. Grießinger (2017): Process-based modeling of tree-ring formation and its relationships with climate on the Tibetan plateau. Dendrochronologia 42:31-41. https://doi.org/10.1016/j.dendro.2017.01.002
- Hochreuther, P., Wernicke, J., Grießinger, J., & A. Bräuning (2017): On the influence of autocorrelation on the significance of wavelet spectral peaks. TRACE – Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology, Vol. 15:54-58. Scientific Technical Report STR 17/04, Potsdam. https://doi.org/10.2312/GFZ.b103-17040.
- Wernicke, J., Hochreuther, P., Grießinger, J., Zhu, H., Wang, L. & A. Bräuning (2017): Multi-century humidity reconstructions from the southeastern Tibetan Plateau inferred from tree-ring δ18O. Global and Planetary Change 149:26-35. https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2016.12.013
- Fu, P.-L., Grießinger, J., Gebrekirstos, A., Fan, Z.-X. & A. Bräuning (2017): Earlywood and latewood stable carbon and oxygen isotope variations in two pine species in southwestern China during the recent decades. Frontiers in Plant Sciences 7:2050. https://doi.org/10.3389/fpls.2016.02050
- Grießinger, J., Helle, G., Hochreuther, P., Schleser, G.H. & A. Bräuning (2017): Late Holocene relative humidity history on the southeastern Tibetan plateau inferred from a tree-ring δ18O record: recent decrease and conditions during the last 1,500 years. Quaternary International 430:52-59. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2016.02.011.
- Wernicke, J., Hochreuther, P., Grießinger, J., Zhu, H., Wang, L. & A. Bräuning (2017): Air mass signals in δ18O of tree-ring cellulose revealed by back-trajectory modeling at the monsoonal Tibetan plateau. International Journal of Biometeorology 61:1109-1124. https://doi.org/10.1007/s00484-016-1292-y
- Huang, R., Zhu, H., Liu, X., Liang, E., Grießinger, J., Bräuning, A., Li, X. & G. Wu (2017): Does increasing intrinsic water use efficiency (iWUE) stimulate tree growth at natural alpine timberline on the southeastern Tibetan Plateau? Global and Planetary Change 148:217-226. https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2016.11.017
2016
- Hochreuther, P., Wernicke, J., Grießinger J., Mölg, T., Zhu, H., Wang, L., & A. Bräuning (2016): Influence of the Indian Ocean Dipole on tree-ring δ18O of monsoonal Southeast Tibet. Climatic Change 137 (1-2):217-230. https://doi.org/10.1007/s10584-016-1663-8
- Titz, A., Grießinger, J. & S. Raven (2016): Naturgefahren und Naturgefahrenmanagement im Oberen Paznauntal/Tirol. Mitteilungen der Fränkischen Geographischen Gesellschaft Bd. 61/62:47-60.
- Bräuning, A., Grießinger, J., Hochreuther, P. & J. Wernicke (2016): Dendroecological perspectives on climate change on the southern Tibetan plateau. In: Singh, E.D., Schickhoff, U. & Mal, S. (Eds.) (2016): Dynamics of Climate, Glaciers and Vegetation in the Himalaya: Contributions towards future Earth initiatives, pp. 347-364, Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-28977-9_17
2015
- Wernicke, J., Grießinger, J., Hochreuther, P. & A. Bräuning (2015): Variability of summer humidity during the past 800 years on the eastern Tibetan Plateau inferred from δ18O of tree-ring cellulose. Climate of the Past 11:327-337, 2015. https://doi.org/10.5194/cp-11-327-2015
- Hochreuther, P.,Loibl, D., Wernicke, J., Zhu, H., Grießinger J. & A. Bräuning (2015): Ages of major Little Ice Age glacier fluctuations on the southeastern Tibetan plateau derived from tree-ring based moraine dating. Palaeogeography, Paleoclimatology, Paleoecology 422:1-10. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2015.01.002
- Wernicke, J., Hochreuther, P., Grießinger, J., Zhu, H., Wang, L. & A. Bräuning (2015): Hydroclimatic variability of the Tibetan plateau during the last Millenium. TRACE – Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology, Vol. 13: 42-48, GFZ Potsdam, Scientific Technical Report STR 15/06, Potsdam. https://doi.org/10.2312/GFZ.b103-15069
- Hochreuther, P., Loibl, D., Wernicke, J., Grießinger, J., Zhu, H. & A. Bräuning.(2015): Tree-ring dating of lateral and terminal Little Ice Age moraines of four glaciers in southeast Tibet. TRACE – Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology, Vol. 13: 116-122, GFZ Potsdam, Scientific Technical Report STR 15/06, Potsdam. https://doi.org/10.2312/GFZ.b103-15069
2014 und älter
- Qin, C., Yang, B., Bräuning, A., Grießinger, J. & J. Wernicke (2014): Drought signals in tree-ring stable oxygen isotope series of Qilian juniper from the arid northeast Tibetan plateau. Global and Planetary Change 125:48-59. https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2014.12.002.
- Wernicke, J., Grießinger, J., Hochreuther, P. & A. Bräuning (2014): Variability of summer humidity during the past 800 years on the eastern Tibetan Plateau inferred from δ18O of tree-ring cellulose. Climate of the Past Discussions 10, 3327-3356. https://doi.org/10.5194/cpd-10-3327-2014
- Loibl, D., Lehmkuhl, F. & J. Grießinger (2014): Reconstructing glacier retreat since the Little Ice Age in SE Tibet by glacier mapping and equilibrium line altitide calculation. Geomorphology 214:22-39, https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2014.03.018.
- Liu, X., Xu, G., Grießinger, J., An, W., Wang, W., Zeng, X., Wu, G. & D. Qin (2014): A shift in cloud cover over the southeastern Tibetan Plateau since 1600: evidence from regional tree-ring δ18O and its linkages to tropical oceans. Quaternary Science Reviews 88:55-68. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2014.01.009.
- Hochreuther, P., Münchow, J., Grießinger, J. & A. Bräuning (2013): Relationships between ring width and maximum lacewood density – an example from southeast Tibet. TRACE – Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology, Vol. 11:10-13, GFZ Potsdam, Scientific Technical Report STR 14/03, Potsdam
- Grießinger, J. & A. Bräuning (2012): Asian Summer Monsoon history in southern Tibet for the late Holocene : Results from a network of tree-ring isotope chronologies. Journal of Nepal Geological Society 45:70-71.
- Hochreuther, P., Grießinger, J. & A. Bräuning (2012): Preliminary results from ring width and latewood density measurements from the southeast Tibetan plateau, China. TRACE – Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology, Vol. 10:20-27, GFZ Potsdam, Scientific Technical Report STR 12/03, Potsdam. https://doi.org/10.2312/GFZ.b103-12036
- Grießinger, J., Bräuning, A., Helle, G., Thomas, A. & G.H. Schleser (2011): Late Holocene Asian summer monsoon variability reflected by δ18O in tree‐rings from Tibetan junipers. Geophysical Research Letters 38, L03701, https://doi.org/10.1029/2010GL045988, 2011.
- Grießinger, J., Bräuning, A., Helle, G., Thomas, A. & G.H. Schleser (2009): 800 years of tree-ring δ18O reflect variability of precipitation in southeastern Tibet. TRACE – Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology, Vol. 7:90-94, GFZ Potsdam, Scientific Technical Report STR 09/03, Potsdam.
- Grießinger, J., Bräuning, A.,Thomas, A. & G. H. Schleser (2008): Stable oxygen isotopes in juniper trees from the Tibetan plateau as a proxy for monsoonal activity. TRACE – Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology. Vol. 6:92-95, GFZ Potsdam Scientific Technical Report STR 08/05.
- Bräuning, A. & Grießinger, J. (2006): Late Holocene variations in monsoon intensity in the Tibetan Himalayan Region – Evidence from tree rings. Journal of the Geological Society of India 68 (3):485-493
Monographien & Sammelbände:
- Grießinger, J. (2019): Perspectives on climate variability and climate change in high-mountain ecosystems using tree-ring parameters. Habilitationsschrift Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 2019.
- Krüger, F. & Grießinger, J. (Eds.) (2019): Botswana 2019. Roadbook zur Großen Exkursion.
- Krüger, F. & Grießinger, J. (Eds.) (2015): 24 Tage durch Mosambik und Südafrika. Roadbook zur Großen Exkursion. Wissenschaftliche Themen und Reiseberichte.
- Grießinger, J. & Titz, A. (Eds.) (2012): Exkursionsführer Wallis 2012. Ergebnisse des Kleinen Geländeseminars für Fortgeschrittene .
- Grießinger, J. & Peters, T. (Eds.) (2011): Exkursionsführer Finnland 2010. Ergebnisse des Großen Geländeseminars Finnland 2011
- Krüger, F. & Grießinger, J. (Eds.) (2010): 24 Tage durch Botswana & Samibia 2010. Roadbook zur Großen Exkursion. Wissenschaftliche Themen und Reiseberichte.
- Grießinger, J. (Ed.) (2009): Karwendel – Exkursion für Fortgeschrittene 2009.
- Grießinger, J. & Gerique, A. (Eds.) (2009): Kleine Exkursion Bayerisches Voralpenland 2009
- Grießinger, J. (2008): Untersuchungen zur Klimavariabilität auf dem Tibetischen Plateau – Ein Beitrag auf der Basis stabiler Kohlenstoff- und Sauerstoffisotopen in Jahrringen von Bäumen waldgrenznaher Standorte. Dissertation Universität Stuttgart, Schriften des Forschungszentrums Jülich . Reihe Energie & Umwelt / Energy & Environment 19.
- Grießinger, J. (2002): Großräumige morphologische Entwicklung im Umfeld der ostfriesischen Insel Wangerooge – Konsequenzen für zukünftige Inselschutzkonzepte. Eine GIS-gestützte Analyse. (Diplomarbeit, Geographisches Institut der Universität Stuttgart).
Posterbeiträge:
- Meier, W., Wernicke, J., Braun, M., Aravena, J., Jana, R., Grießinger, J. (2016): Climate variability reflected by tree-ring width and δ18O in a heavily glaciated area of the Patagonian Andes since the Little Ice Age. AGU Fall Meeting 2016, San Francisco, USA.
- Grießinger, J., Hochreuther, P., Loibl, D., Zhu, H., Bräuning, A. (2015): Late Holocene monsoonal dynamics in SE-Tibet derived from glacial evidence and tree-ring δ18O. AAG Annual Meeting 2015, Chicago, USA.
- Hochreuther, P., Grießinger, J., Wernicke, J., Zhu, H., Bräuning, A. (2014): Reaction of monsoonal temperate valley glaciers in southeast Tibet to climate change inferred from tree-ring proxies. EGU General Assembly 2014, Wien, März 2014.Loibl, D., Grießinger, J. & F. Lehmkuhl (2014): Glacier retreat since the Little Ice Age in the eastern Nyainqêntanglha Range, southeastern Tibet. EGU General Assembly 2014, Wien, März 2014.
- Wernicke, J., Grießinger, J., Hochreuther, P., Zhu, H., Wang, L. & Bräuning, A. (2014): Hydroclimatic reconstructions and variability research on the Tibetan plateau inferred from δ18O in tree-ring cellulose. CAME/CLASH Meeting, Frankfurt, März 2014.
- Hochreuther, P., Grießinger, J. & Bräuning, A. (2013): Gletscherdynamik in Südosttibet – eine dendroklimatologische Studie. Arbeitskreis Hochgebirge General Assembly, Bonn, März 2013.
- Hochreuther, P., Grießinger, J. & Bräuning, A. (2012): Deconstruction of ring width- and wood density relationships – a case study from the southeastern Tibetan plateau.” Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology (TRACE) 2012, Potsdam, April 2012.
- Hochreuther, P., Grießinger, J. & Bräuning, A. (2012): Accessing glacial history through tree rings – a case study from southeast Tibet. International Geographic Congress (IGC) 2012, Köln, Oktober 2012.
- Grießinger, J., Bräuning, A. & Schleser, G.H. (2007): Stable oxygen isotopes in juniper and spruce trees from the Tibetan plateau. TRACE – Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology (Poster). Mai 2007, Riga, Lettland.
- Grießinger, J., Bräuning, A. & Schleser, G.H. (2004): Isotope studies along a high-elevation transect on the Tibetan Plateau. TRACE- Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology. April 2004, Birmensdorf, Switzerland.
- Grießinger, J., & Bräuning, A. (2004): Isotopenphysikalische Untersuchungen an tibetischen Waldgrenzstandorten zur Analyse der Monsunvariabilität in den letzten 2000 Jahren. Arbeitskreis Hochgebirge, Januar 2004, Giessen.
Überblick über aktuelle und bisher abgehaltene Lehrveranstaltungen (Stand 11/2022):
Große Exkursionen: 18
Kleine Exkursionen: 14
Seminare: 35
Methodenkurse/Übungen: 23
Vorlesungen: 6
(Labor)Praktika: 11
Repetitorien: 13
- WS 2020/2021 (3 LV´s): Examenskurs/Repetitorium Physische Geographie, Projektorientiertes Hauptseminar „Naturgefahren im Hochgebirge“, Hauptseminar „Landschaftsgeschichte Deutschlands“
- SoSem 2020 (3 LV´s): Seminar zur Großen Exkursion „Norwegen“; Examenskurs/Repetitorium Physische Geographie
- WS 2019/2020 (3 LV´s): Examenskurs/Repetitorium Physische Geographie, Projektorientiertes Hauptseminar „Geoökologische Raumanalyse“, Vorlesung „Ökozonen der Erde“
- SoSem 2019 (2 LV´s): Seminar zur Großen Exkursion „Skandinavien“ (gemeinsam mit Dr. T. Peters) ; Große Exkursion „Skandinavien“ (gemeinsam mit Dr. T. Peters)
- WS 2018/2019 (3 LV´s): Examenskurs/Repetitorium Physische Geographie, Seminar zur Großen Exkursion „Botswana, Namibia, Sambia“ (gemeinsam mit Prof. F. Krüger) ; Große Exkursion „Botswana, Namibia, Sambia“ (gemeinsam mit Prof. F. Krüger)
- SoSem 2018 (1 LV): Kleines Geländeseminar Stuttgart und Umgebung
- WS 2017/2018 (1 LV): Examenskurs/Repetitorium Physische Geographie
- SoSem 2017 (2 LV´s): Hauptseminar Geomorphologie, Regionales Seminar Finnland, Große Exkursion Finnland (gemeinsam mit Dr. T. Peters)
- WS 2016/2017 (1 LV): Seminar Karteninterpretation
- SoSem 2016 (3 LV´s): Seminar zur Großen Exkursion „Nordsee“; Große Exkursion Nordsee; Examenskurs/Repetitorium Physische Geographie
- WS 2015/2016 (2 LV´s): Vorlesung Regionale Geographie der Hochgebirge; Seminar Karteninterpretation
- SoSem 2015 (2 LV´s): Lehrforschung Africulture (gemeinsam mit Prof. F. Krüger & Dr. A. Titz); Geländepraktikum für Anfänger
- WS 2014/2015 (4 LV´s): Lehrforschung Africulture (gemeinsam mit Prof. F. Krüger & Dr. A. Titz); Exkursionsseminar Nepal (gemeinsam mit Dr. A. Titz); Großes Geländeseminar Nepal (gemeinsam mit Dr. A. Titz); Vorlesung Einführung in die Physische Geographie
- SoSem 2014 (4 LV´s): Kleines Geländeseminar Stuttgart und Umgebung (gemeinsam mit Dr. A. Titz); Projektseminar Naturgefahren und Naturgefahrenmanagement; Exkursionsseminar Mosambik ; Große Exkursion Mosambik (gemeinsam mit Prof. F. Krüger)
- WS 2013/2014 (2 LV´s): Übung Karteninterpretation; Lehrforschung MSc: Umweltwandel, Naturschutz und Existenzsicherung im Entwicklungskontext (Botswana)
- SoSem 2013 (4 LV´s): Seminar Dendroökologie; Große Exkursion Finnland (gemeinsam mit Dr. T. Peters); Exkursionsseminar Finnland; Kleine Exkursion Stuttgart und Umgebung
- WS 2012/2013 (3 LV´s): Große Exkursion Nepal (gemeinsam mit Dr. A. Titz); Hauptseminar Nepal; Seminar Hoch und Zentralasien; Examens-Vorbereitungskurs Lehramt
- Sosem 2012 (6 LV´s): Kleine Exkursion Karwendel; Kleine Exkursion Oberes Engadin; Lehrforschung Master of Science Yunnan/China (gemeinsam mit Prof. A. Bräuning); Lehrforschung Master of Science: Umweltwandel in den Südalpen (Praxis) (gemeinsam mit 4 weiteren Dozenten); Projektseminar Naturgefahren und Naturgefahrenmanagement (gemeinsam mit Dr. A. Titz); Projektseminar Dendroökologie
- WS 2011/2012 (7 LV´s): Seminar Africulture (gemeinsam mit Prof. F. Krüger); Hauptseminar Umkämpfte Räume, umstrittene Ordnungen, Umbruch und Stabilität im südlichen Afrika (gemeinsam mit Prof. F. Krüger); Große Exkursion Namibia/Botswana (gemeinsam mit Prof. F. Krüger); Übung Karten- und Luftbildinterpretation Kurs A; Übung Karten- und Luftbildinterpretation Kurs C; Lehrforschung Master of Science: Umweltwandel in den Südalpen (Theorie); Seminar Fennoskandinavien
- SoSem 2011 (5 LV´s): Kleine Exkursion für Fortgeschrittene Wallis (gemeinsam mit Dr. A. Titz); Kleine Exkursion Karwendel; Seminar Geomorphologie; Seminar Physische Geographie der Polargebiete Kurs I; Seminar Physische Geographie der Polargebiete Kurs II; Große Exkursion Alpen (gemeinsam mit Prof. W. Bätzing)
- WS 2010/2011 (4 LV´s): Praktikum Dendroökologie; Vorlesung Einführung in die Kartographie; Übung Karten- und Luftbildinterpretation; Seminar Landschaftsgeschichte Süddeutschlands
- SoSem 2010 (5 LV´s): Seminar Physische Geographie Hoch- und Zentralasien; Große Exkursion Alpen/Gastein (gemeinsam mit Prof. W. Bätzing); Große Exkursion Finnland (gemeinsam mit Dr. T. Peters); Exkursionsseminar Finnland (gemeinsam mit Dr. T. Peters); Kleine Exkursion Karwendel
- WS 2009/2010 (7 LV´s): Übung Luftbildinterpretation; Projektseminar Dendroökologie; Seminar Globale Ressourcen (gemeinsam mit Dr. A. Gerique); Seminar Fennoskandinavien; Kleine Exkursion Südlicher Chiemgau (gemeinsam mit Dr. F. Voll); Hauptseminar Geographien der Gewalt und des Risikos im subsaharischen Afrika; Große Exkursion Botswana/Sambia (gemeinsam mit Prof. F. Krüger)
- SoSem 2009 (4 LV´s): Seminar Physische Geographie der Polargebiete; Seminar Geoökologische Raumanalyse; Seminar zur großen Exkursion China (gemeinsam mit Prof. A. Bräuning); Übung Luftbildinterpretation; Kleine Exkursion Bayer. Voralpenland; Kleine Exkursion Karwendel; Große Exkursion China (gemeinsam mit Prof. A. Bräuning); Geländepraktikum (gemeinsam mit 4 weiteren Dozenten)
- WS 2008/2009 (3 LV´s): Proseminar Physische Geographie Fennoskandinaviens; Übung Karteninterpretation; Übung Luftbildinterpretation; Laborpraktikum Dendroökologie (gemeinsam mit Prof. A. Bräuning)
- SoSem 2008 (4 LV´s): Proseminar Geomorphologie; Übung Luftbildinterpretation; Kleine Exkursion Görlitz; Geländepraktikum (gemeinsam mit 4 weiteren Dozenten)
- WS 2007/2008 (4 LV´s): Proseminar Geomorphologie; Übung Karteninterpretation; Übung Luftbildinterpretation; Laborpraktikum Dendroökologie (gemeinsam mit Prof. A. Bräuning)
- SoSem 2007 (2 LV´s): Übung Einführung in die Kartographie und Geländebeobachtung; Übung Luftbildinterpretation
- WS 2006/2007 (2 LV´s): Übung Einführung in die Kartographie und Geländebeobachtung; Laborpraktikum Dendroökologie (gemeinsam mit Prof. A. Bräuning)
Fachgebiete und Arbeitsschwerpunkte: Mensch-Umwelt-Interaktionen in Hochgebirgen, Klima- und Gletschergeschichte, Naturgefahren im Hochgebirge, Stoffdynamik Atmosphäre-Biosphäre-Geosphäre, Hydrologischer Kreislauf
Regional
- Asien mit den Schwerpunkten Tibetisches Plateau, subtropisches Süd-China (Yunnan), Pakistan, Indien & Nepal
- Südamerika: Patagonien & Tierra del Fuego
- Europäische Alpen
Methodisch
- Paläoklimatologie / Dendroökologie / Dendroklimatologie
- Stabile Isotope in der Umweltforschung (C, O, D/H)
- Globaler Wandel und Auswirkungen auf (Wald-)Ökosysteme und den Wasserkreislauf
- Stoffdynamik Atmosphäre – Biosphäre/Hydrosphäre – Geosphäre/Pedosphäre
- Klima- & Landschaftsgeschichte
- Klimatisch induzierte Fragestellungen zu Naturgefahren
Forschungsthemen und -interessen
- Untersuchungen zur Klimavariabilität und zu Auswirkungen des Klimawandels in Hochgebirgs-Ökosystemen
- Klima-, Gletscher- und Landschaftsgeschichte Hochasiens und Südamerikas
- Klimawandel und Naturgefahren
- Mensch-Umwelt Interaktionen in Hochgebirgen
Aktuell laufende Forschungsprojekte (Stand 1/2021)


Rolle: Projektleiter (PI)
Kooperationsprojekt mit der Universidad de Magallanes; Punta Arenas/Chile; Universidad Austral de Chile; Valdivia/Chile und der Pontíficia Universidad Católica de Valparaíso; Valparaíso/Chile.
Der deutsch-chilenische Projektverbund AVOID (Adaptation and Vulnerability of NOthofagus forests to drought-Induced risks and Disasters in Central and Southern Chile) hat zum Ziel, initial bestehende Forschungskooperation zu vertiefen und langfristig zu etablieren. Das fachliche Ziel der wissenschaftlichen Zusammenarbeit während der geplanten Laufzeit ist es, in vier ausgesuchten Regionen Mittel- und Süd-Chiles das Ausmaß und den Einfluss der rezent ablaufenden Klimaänderung in CHILE auf die Adaptions- und Regenerationsfähigkeit der durch massive Waldbrände gefährdeten Nothofagus-Wälder zu untersuchen, und die seit 100 Jahren anhaltende z.T. extrem ausgeprägte Trockenphase in Mittel- und Südchile in einen längerfristigen (paläo)klimatischen Kontext zu bringen und zu erklären. Daraus hervorgehend ist geplant, aus den gewonnenen Informationen ggfs. nötige Handlungsempfehlungen für lokale Akteure zu generieren, um so einen Beitrag zur bisher z.T. noch lückenhaften Umwelt-, Risiko- und Klimaforschung im südlichen Südamerika zu leisten.
Weitere Projektbeteiligte an der FAU: Dr. Mohsen Arsalani, Dr. Wolfgang Meier, Pamela Soto-Rogel
![]()

Rolle: Projektleiter (PI)
Kooperationsprojekt mit der Tree-Ring Science Group des Xishuangbanna Tropical Botanical Garden der Chinese Academy of Sciences
During the recent decades, the topographically complex province of Yunnan in southwest China experienced substantial trends of increasing temperatures, accompanied by an increasing number of precipitation failures. This may challenge the sustainability of forest ecosystem services like carbon sequestration and biodiversity conservation. The Sino-Geman cooperation project YunForest evaluates the effects of a changing climate to the adaptation of natural and anthropogenic forest ecosystems in three elevation transects along a south-north climatic gradient in the tropical, subtropical and temperate climate zones of YUNNAN/CHINA. In an interdisciplinary study, different wood anatomical parameters/features and tree physiological information derived from analyses of stable oxygen and carbon isotopes in tree-ring cellulose will be used to quantify forest growth and tree species’ response to changes in regional hydroclimate. Multicentennial climate variability along the Mekong river system will be reconstructed using a multi-tree-ring parameter approach. Extreme precipitation events will be analyzed along the studied gradients by analyzing the fractionation of stable oxygen isotope composition in precipitation and wood and calculating the origin of the air masses by trajectory analyses. This will allow modelling of stable oxygen fractionation along atmosphere travel pathways and linkage to intra-annual distribution of oxygen isotopes in tree rings.
weitere Projektbeteiligte an der FAU: Prof. Achim Bräuning, Dr. Wolfgang Meier, Sugam Aryal

Rolle: Projektmitarbeiter
The linkage between mountain environments and biodiversity is a conspicuous pattern in biogeography. A key area to study such links is the Himalaya, where ecotypic polymorphism is common across different valleys due to environmental variability and geographic isolation. Hence, populations of a plant species found in isolated valleys may represent different ecotypes, with ability to adapt to different climatic conditions. This project aims to determine ecotypes of the ecologically and commercially important conifer species Abies spectabilis and Pinus wallichiana along their high-elevation and low-elevation distribution in the NEPAL Himalaya and will evaluate differences in their adaptive potential. An innovative combination of plant anatomical, dendroecological, genetic, and stable isotope approaches are applied to assess the morphological, physiological, and molecular characteristics of ecotypes of the study species in light of their adaptability to climate change. The results should serve as a basis for future forest management plans and can the methodology may be transferred to mountain forest regions worldwide.
weitere Projektbeteiligte an der FAU: Prof. Achim Bräuning, Dr. Wolfgang Meier, Sugam Aryal
Rolle: Projektleiter Workgroup 2
Kooperationsprojekt mit dem Institute of Tibetan Plateau Research (ITP) der Chinese Academy of Sciences
Glaciers on the Tibetan plateau (TP) experienced dramatic rates of retreat during the past decades. At the same time, the warming climate has resulted in an extension of the growing season on the one hand, but to reduced summer monsoon activity on the other hand. Winter season has become shorter and warmer, resulting in a reduced snow cover and thus reduced water availability for vegetation during the dry pre-monsoon season. Beside an increased meltwater supply, receding glaciers have multiple effects on landscape dynamics, which are hardly studied on the TP, and which interact with the aggravating change of regional climate conditions. The project will combine climate modeling, remote sensing, dendroecology, and growth modeling on different temporal scales in a novel and interdisciplinary approach. The main aim is to enhance the understanding of process chains between climate dynamics and landscape change, glacier responses to changing monsoon dynamics, responses of the regional water budget, and vegetation dynamics. Given that annually and seasonally resolved dendroecological time series reveal rather immediate couplings between climate and tree growth variations, whilst glacier and hydrologic responses are considered delayed by internal system dynamics, a particular focus will be laid on the analysis of system-specific response times. Stable oxygen isotopes will be used as tracers to analyze the complex process chain from incoming precipitation, glacier melt water, up to vegetation response. The project will apply and develop various modeling tools, including climate and glacier mass balance models, cambial growth models, which will also be run for future climate change scenarios. The approach will be tested in a glaciated case study catchment on the eastern TP, and the implementation of different models for partial landscape compartments will be integrated in a way that can be transferred to other mountain regions.
weitere Projektbeteiligte an der FAU: Prof. Achim Bräuning, Prof. Thomas Mölg, Prof. Matthias Braun, Dr. Wolfgang Meier, Sugam Aryal
Rolle: Projektleiter (PI)
Das von der Hertha und Helmuth Schmauser Stiftung geförderte Projekt zielt darauf ab, die komplexen Wechselbeziehungen zwischen sich änderndem Klima, dem massiven Rückgang von vergletscherten Flächen, einer daraus resultierenden veränderten Wasserverfügbarkeit bei zunehmender Trockenheit, und einer hoch spezialisierten lokalen Bewässerungs-Landwirtschaft und Tourismus-Infrastruktur im Sagarmatha-Himalaya Nepals zu untersuchen. Hierbei liegt der Schwerpunkt in der Aufnahme und ersten quantitativen Analyse des regionalen Klima- und Umweltwandels in den vergangenen Dekaden. Erste Studien aus der glazial geprägten Region schildern zum Teil tief greifende Umwälzungsprozesse und Wanderungsbewegungen der Lokalbevölkerung mit damit verbundener Teil-Aufgabe von Dauersiedlungen, die sich im nepalesischen Hoch-Himalaya in der letzten Dekade aufgrund fundamentaler Änderungen in der lokalen Wasserverfügbarkeit vollzogen haben. Hier ist insbesondere ein persistenter Trend hin zu trockeneren Bedingungen in der Vegetationsperiode zu nennen, der die lokale Landwirtschaft vor fundamentale Herausforderungen stellt. So zeigt sich in der Abnahme der Wasserverfügbarkeit durch lokale glaziale Schmelzwässer auch eine Änderung der Abflussspitzen, die in Kombination mit dem überregionalen Gletscherrückgang die Lokalbevölkerung teilweise zur Aufgabe ihrer landwirtschaftlichen Anbauflächen und Siedlungen zwingen. Hiervon betroffen ist die in den letzten Jahrzehnten massiv ausgebaute Tourismus-Infrastruktur vor allem in puncto Wasserverfügbarkeit v.a. für die sanitäre Versorgung der immensen Touristenströme. Eben dieser Ausrichtung auf Tourismus haben sich viele der ehemaligen Bauern in der Region als Ersatz für ihre landwirtschaftliche Tätigkeit gewidmet und stehen nun aufs Neue vor einer existenzbedrohenden Lage.
Rolle: Projektleiter (PI)
Klimaveränderungen beeinflussen auch in Franken das Auftreten von Dürren und Spätfrosten. Änderungen in deren Frequenz und Dauer haben direkte Auswirkungen auf die Vegetation und die landwirtschaftliche Produktion. Im Rahmen eines gemeinsamen Projektes haben das Institut für Geographie der FAU, der Lehrstuhl für Klimatologie der Universität Bayreuth und das Landratsamt Forchheim als Projektteilnehmer des EU-Projektes STRENCH in Kooperation mit dem Wildpark Hundshaupten an verschiedenen Standorten in der Region Klimastationen und Band-Dendrometer an Bäumen installiert, um Informationen über die Zusammenhänge zwischen Trockenheit und Anpassungsfähigkeit von Streuobstbeständen verschiedener Expositionen und Höhenlagen zu sammeln. Die Kombination aus Klimamesswerten und direkt messbarer Reaktion der instrumentierten Bäume soll es dabei ermöglichen, eine unmittelbare Zuordnung der Auswirkungen von Hitze- und Trockenphasen auf die Streuobstbestände zu quantifizieren und weiterführende Handlungsempfehlungen für die lokalen Obstbauern zu generieren.
Einen Überblick der aktuellen Witterungsbedingungen (und denen des vergangenen Monats) im Untersuchungsgebiet bieten die Daten zweier automatischer Klimastationen der Universität Bayreuth, die zum einen auf einer Weissjura-Hochfläche im Wildpark Hundshaupten und zum anderen in der Auenniederung der Trubach bei Oberzaunsbach stehen. Besuchern des Wildparks wird zudem auf entsprechenden Infotafeln weiterführendes Hintergrundwissen zum Projekt und den erhobenen Daten näher gebracht.
Projektbeteiligte der FAU: Dr. Wolfgang Meier
- KLIGAnd – Klimarekonstruktion, Eisdynamik und geodätische Gletschermassenbilanzen in den südlichen Anden (PI – Projektförderung durch das BMBF 2015-2019) im deutsch-chilenischen Projektverbund „Responses of Glaciers, Biosphere and Hydrology to Climate variability and climate change across the Southern Andes (GABY-VASA)“
- NepalRing (Co-PI – Projektförderung durch das BMBF 2015-2017)
- Klimawandel als Ursache für tiefgreifende hydrologische Änderungen im Oberen Mustang/Nepal (PI – Projektförderung durch die Dr. Hertha und Helmut Schmauser-Stiftung 2015-2016)
- ClimRol – Climate Change in the Rolwaling-Himalaya/Nepal for the past centuries. (PI – Projektförderung durch die Bayerische Forschungsallianz 2014)
- Monsoonal variations and climate change during the late Holocene derived from tree rings and glacier fluctuations im Rahmen des DFG SPP 1372 Tibetan Plateau: Formation – Climate – Ecosystems (TiP) (PI – Projektförderung durch die DFG 2011-2015)
- CLASH – Climate variability and landscape dynamics in SE-Tibet and the eastern Himalaya during the late Holocene reconstructed from tree rings, soils and climate modelling. (PI – Projektförderung durch das BMBF 2011-2014)
- Monsoon Variability, Climate Change, Tree-Ecology and sustainable land use in the Ailao Shan Mountains, China. (Co-PI – Projektförderung durch die Robert-Bosch-Stiftung 2011-2014)
 |
 |
>> Ab dem WS 2023/24 werden von mir keine Abschlussarbeiten mehr zur Betreuung angenommen <<
Betreut werden Studierende der Studiengänge BSc, MSc sowie alle Lehramtsstudiengänge. Aktuell werden AbsolventInnen aller Studienrichtungen gesucht, die sich für Themen zur Landschafts- und Klimageschichte sowie zu Naturgefahren in Hochgebirgen (Asien, Europa, Südamerika) interessieren. Der Schwerpunkt liegt hierbei zum Einen in Literaturarbeiten zu den genannten Themen (Stand der Forschung, rezente Entwicklungen, aktuelle Fallbeispiele zum Georisiko und Georisikomanagement in Hochgebirgsregionen, Hazardforschung) als auch Arbeiten zu glaziologischen und paläoklimatischen Themenbereichen (Paläoklimaforschung, Klimafolgenforschung, Fernerkundung) in den genannten Naturräumen. Weiterführende Informationen sowie eine regionale und inhaltliche Eingrenzung der allgemein genannten Themen erhalten Interessierte nach Voranmeldung in meiner Sprechstunde.
Themenvorschläge Abschlussarbeiten /Aktuell zu vergebende Themen:
- Infrastrukturelle Entwicklung eines nepalesischen Pilgerortes in den vergangenen 25 Jahren (Methode GIS / Kartographie)
- Satellitengestützte Detektierung von gletschernahen Baumstandorten in Hochasien (Provinzen Sichuan und Yunnan /China) (Methode: GIS/Fernerkundung)
- Auswirkungen der vergangenen Megadrought in Südchile auf die Regenerationsfähigkeit regionaler Südbuchen-Populationen (Methode: Stabile Isotope, Dendroklimatologie, Ökologie)
- Die Nutzung von Zwergsträuchern als Klimaproxy – Eine komparative Analyse aus dem nepalesischen Himalaya (Methode: Dendro / δ18O)
- Zudem gibt es immer die Möglichkeit, Abschlussarbeiten zu /in laufenden Projekten zu schreiben (vorrangig Studierende der Studiengänge Lehramt vertieft mit naturwiss. Schwerpunkt oder Master of Science). Bitte lesen Sie dazu vorab auch die entsprechenden Projektbeschreibungen im Reiter „Forschung“.
Betreute Abschlussarbeiten
- Britta Hafenecker (2010): Verwertungsmöglichkeiten von Grünschnitt aus Naturschutz- und Landschaftspflegemaßnahmen im Raum Nürnberg Süd. (Zweitgutachter; Erstgutachter Prof. R. Bäumler)
- Dirk Haas (2011): Integration und Management heterogener jahrringökologischer Datensätze durch die Generierung einer relationalen Datenbank. (Zweitgutachter, Erstgutachter Prof. A. Bräuning)
- Martin Grünbeck (2012): Auf dem Weg zur nachhaltigen Stadtentwicklung – Grundlagen, Handlungsbedarf und Visionen auf Basis aktueller Praxisbeispiele. (Zweitgutachter; Erstgutachter Prof. R. Bäumler)
- Michael Schwinn (2012): GIS-gestützte Modellierung von Gefahrenzonen durch gravitative Massenbewegungen an den Verkehrswegen um Loja, Südecuador – Eine vergleichende geomorphologische Studie als Beitrag zur geographischen Hazardforschung. (Zweitgutachter; Erstgutachter Prof. R. Bäumler)
- Katarzyna Gabrys (2012): Vergleiche der Bodenbildungen an West- und Osthängen im Bereich der Nördlichen Frankenalb (Hetzleser Berg). (Zweitgutachter; Erstgutachter Prof. R. Bäumler
- Tanja Häfner (2012): Raumanalyse zur Ermittlung und Beurteilung von Konversionsflächen/Freiflächen im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz zur Umnutzung mit Erneuerbaren Energieträgern. (Zweitgutachter; Erstgutachter Prof. R. Bäumler).
- Michael Neumann (2010): Erstellung und Umsetzung eines GPS-gestützten Wanderführers mit Hilfe des Software Programmes ArcGIS 9.3.1. (Zweitgutachter; Erstgutachter Prof. A. Bräuning)
- Thorsten Lajoie (2012): Stabile Sauerstoffisotope zur Untersuchung der Permafrostdynamik in einem subalpinen Lärchenbestand im Val Bever/Schweiz.
- Jasmin Arnhardt (2013): Der Klimawandel im Hochgebirge und seine Auswirkungen am Beispiel des Gletscherwandels im Himalaya und Karakorum.
- Tilman Kiesel (2013): Die Entwicklung der Schweizer Gletscher unter dem Einfluss des Klimawandels. Eine Analyse regionaler Vergletscherung seit 1850.
- Susanne Schindler (2013): Die samische Rentierwirtschaft in Skandinavien – Ihre Veränderungen, Probleme und Konflikte seit dem 20. Jahrhundert.
- Natalie Aures (2014): δ13C-Variationen als Nachweis eines sich ändernden CO2-Partialdrucks in einem subalpinen Hochgebirgs-Ökosystem.
- Marion Schweighart (2014): Reflecting on changing climate in South Africa: Physical change, vulnerability and coping strategies for facing complexity and uncertainty.
- Cornelia Kern (2014): Darstellung regenerativer Energieträger mit Anwendungsbeispielen der nahezu stromautarken Stadt Haßfurt.
- Marc Oertelt (2014): Verwundbarkeit und Anpassungsfähigkeit traditioneller Landnutzungssysteme Nepals unter dem Einfluss des Klimawandels.
- Markus Meier (2015): Hazards und Hazardmanagement in einem Entwicklungsland – das Beispiel Nepal.
- Christian Schwerdtfeger (2016): Georessourcen – Afrika: Entwicklungsländer und Ressourcenfluch.
- Simon Voll (2017): Klimavariabilität und Gletscher in Patagonien. Analyse der δ18O-Variationen und Jahrringbreiten von Nothofagus-Spezies zur Rekonstruktion des lokalen Klimas.
- Marco Steinmetz (2018):Der Klimawandel und dessen Auswirkungen auf den Tourismus in der Nordsee-Region.
- Christoph Bau (2019): Naturgefahren in der Hindukush-Karakorum-Himalaya-Region.
- Jamie Baeck (2019): Die horizontale und vertikale Vegetationszonierung Skandinaviens unter Berücksichtigung möglicher Auswirkungen durch den Klimawandel.
- Laurin Haimerl (2019): Bildungsforschung International – das finnische Bildungswesen: Beeinflussende Paradigmen, epmirische Fundierung, struktureller Aufbau und globales Nutzungspotential im 21. Jahrhundert.
- Leonie Großl (2020): Öko-Tourismuskonzepte für das Nürnberger Land.
- Christina Distler (2022): Was wird aus dem heimischen Wald? Der Einfluss des Klimawandels auf den bayerischen Forst und Möglichkeit einer angepassten Waldbewirtschaftung an Fallbeispielen aus der Oberpfalz.
- Markus Hacker (2022): Lachsaquakulturen in Norwegen.
- Benjamin Köstler (2011): Vergleichende Analyse von Gletscherschwankungen in den Alpen und im Großen Kaukasus.
- Karolin Döringer (2013): Vergleich des Naturgefahrenmanagements in Österreich und der Schweiz.
- Tobias Schneider (2012): Georisikomanagement als Reaktion auf Naturrisiken und –katastrophen – Eine vergleichende Analyse und Bewertung der Veränderung des Georisikos und der Entwicklung des alpinen Naturgefahrenmanagements anhand der Fallbeispiele Pontresina und der Talschaft Arieschbach (Engadin/Schweiz).
- Regina Fleischmann (2014): Fluviale Geomorphodynamik und die Wahrnehmung der resultierenden Risiken in der Bevölkerung von Kagbeni, Nepal.
- Alexandra Zuhr (2015): Untersuchungen zur Klimavariabilität im Manaslu-Himalaya anhand von Sauerstoffisotopen in Bäumen.
- Jakob Ank (2015): Glaziale Dynamik der letzten 100 Jahre in Patagonien.
- Marvin Liedtke (2016): Ereignisanalyse und Modellierung des Murgangs vom 31.01.2016 im Teufbach (Schweiz).
- Matthias von Stackelberg (2016): Analyse der Flächenänderungen von ausbruchsfähigen Gletscherseen im Nord- und Südwestpamir mit R und ArcGIS.
- Simone Raven (2016): Die Naturgefahr Hochwasser und Hochwasserrisikomanagement. Untersuchung des Umsetzungspotenzials von dezentralen Schutzmaßnahmen anhand eines Fallbeispiels in Tröstau/Oberfranken.
- Paula Rothenberger (2020): Der Urban Sprawl in Kathmandu – die Auswirkungen signifikant zunehmenden Flächenverbrauchs und daraus entstehende Risiken für Mensch und Umwelt.
- Aline Löffler (2020): Evaluierung des Gefährdungspotentials von Sturzereignissen am Beispiel des Kantons Graubünden/Schweiz.
- Jan Schmidt (2021): Einfluss des Klimawandels auf gravitative Massenbewegungen und das Potenzial der Vorhersage zur Installation von Warnsystemen.
- Moritz Worschech (2022): Eine geoökologische Analyse des geplanten ICE-Instandhaltungswerkes Nürnberg-Altenfurt
- Chiara Carnevale (2022): Auswirkungen des Klimawandels auf das Kali Gandaki Tal/Nepal
- Sarah Zenner (2022): Analyse der Naturgefahr Hochwasser mit abschließendem Vergleich zum Jahrhunderthochwasser im Ahrtal.
- Tamara Korencan (2022): Die rezente Entwicklung proglazialer Seen und zunehmendes GLOF-Potential im Himalaya.
- Florian Ziegler (2022): Veränderungen in Namche Bazar seit 1996 – eine kartographische Darstellung.
- Annika Boigs (2022): Biologische Landwirtschaft und deren Vergleich mit konventioneller Landbau hinsichtlich agrarischer Rahmenbedingungen und individueller Umweltverträglichkeit.
- Sven Rabus (2022): GIS gestützte Standortanalyse für mögliche Photovoltaikflächen in der Verwaltungsgemeinschaft Saal.
- Louisa Simon (2023): Analyse von gravitativen Massenbewegungen im Kali Gandaki Tal/Nepal
- Simon Gügel (2023): Holozäne Veränderungen der patagonischen Eisfelder
- Anna-Katharina Franke (2013): O2-Mangel durch Stauwasser als Auslöser von Eichenschäden in Unterfranken
- Sascha Scharpff (2015): Naturgefahren und Sicherheitsbedürfnis in einem durch Massentourismus geprägten alpinen Raum: das Beispiel Galtür/Tirol.
- Claudia Benz (2015): Landnutzungsveränderung und Urban Sprawl im Kathmandutal, Nepal.
- Natascha Lehmann (2016): Untersuchungen zur Landnutzung und möglichen Auswirkungen des Klimawandels in Mustang, Nepal. Eine empirische Fallstudie in den Dörfern Dankardzon, Phallyak, Piklin und Yule.
- Tilman Kiesel (2017): Risikoanalyse und Managementstrategien des Klimaschutzes und der Klimaanpassung am Beispiel des Freistaates Bayern.
- Simon Grotter (2021): Land Use Change in the Mustang Himalaya – a bi-temporal satellite data analysis.